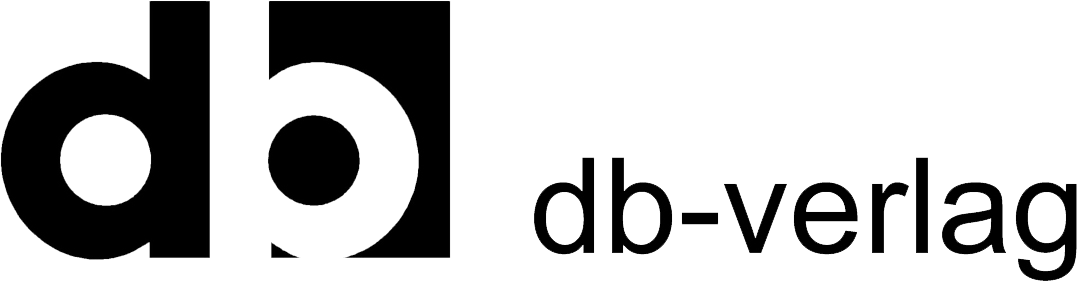Medien
Buchrezensionen
«Es werden wieder Tage sein» (Jacqueline Keune)
Buchrezension von Felix Senn
Noch sind sie nicht, die Tage. Kriege verdunkeln den Himmel und Hass vergiftet die Herzen der Menschen. Opfer gibt es zu Tausenden hüben und drüben, sinnlos getötet oder verwundet und traumatisiert für immer. – Die Theologin und Theopoetin Jacqueline Keune legt ein neues Buch vor mit Texten, die nichts beschönigen und die Trümmer der jüngsten Kriege schonungslos ins Wort bringen. Und trotz alledem – oder gerade deswegen – will sie das Träumen und Hoffen auf keinen Fall lassen.
Der Spagat ist riesig: Schon das erste Gedicht spricht von Zerstörung, Ohnmacht und Verzweiflung in Zeiten des Krieges, aber auch von Keunes Hoffnung („Meine Hoffnung“) im unscheinbar Kleinen: im Grün der Natur, in menschlicher Scham und im Zorn; in himmlischen Gesten der Zuwendung. Hoffnung, diese unzerstörbare Kraft, diese göttliche Tugend, ist fragil und anders nicht zu haben als mit offenen Augen und und einfühlsamem Blick auf all die Gräuel. Das ändert sich nicht durch all die Texte hindurch. Auch im letzten („Einmal“) ist das Elend von Mord, Zerstörung und Krieg noch immer omnipräsent und die Hoffnung immer noch leise und dennoch unerschütterlich. Das macht Keunes Texte so authentisch, so unverwechselbar. Die Autorin ist eine wache Zeitgenossin, lässt sich voll ein auf das dramatische Zeitgeschehen, ist empfindsam für Leid, Verletzung und Schmerz. Und zugleich ist sie tief verwurzelt in der biblischen Botschaft, tief gläubige, spirituelle Frau und differenzierte Theologin. In ihren Texten wird Hoffnung nicht wohlfeil geboten, um alles zu übertünchen. Sie kennt ihre Bibel genau und bringt zur Sprache, wie auch dort Leid und Schmerz, Mord und Krieg nicht ausgeblendet werden. Dennoch schafft sie es, unter all den Trümmern der Geschichte und der Gegenwart Spuren von Glauben und Hoffnung, von Träumen und Zuversicht zu entdecken und ans Licht zu bringen. Das macht ihre Texte glaubwürdig – und ja: zutiefst wahr. Die Bilder von Silvia Hess Jossen sind diskret; sie schaffen teilweise eine beklemmende Stimmung in schwarz-weiss, zeigen die Gefährdung der Erde in rostrot oder sind vorsichtig pastellfarben vernetzend. Sie unterstützen so die Botschaft von Keunes Texten.
Diese unglaubliche Spannung zwischen schierer Ausweglosigkeit ob Gewalt und Krieg und unbändiger Hoffnung trotz allem durchzieht wie ein roter Faden alle Texte dieses Bandes. Es sind ganz unterschiedliche Texte darunter: Gedichte, Gebete, Psalmen und Segenswünsche. Oft sind konkrete Ereignisse, Orte und Zeiten Aufhänger für einen Text. Dabei legt die Reihenfolge theologisch eine weitere Spur durch die Texte: mit dem „Kirchenjahr“ oder besser den biblischen Festzeiten von Advent über Neujahr, Pessach bis Pfingsten und Maria Himmelfahrt und weiter über die Segensgebete und persönlichen Segensbitten bis hin zum eschatologischen Horizont: „Einmal…“
Aber dennoch bleibt jeder Text eigenständig. Und man sollte jeden einzelnen auf sich wirken lassen. Es ist nicht der Sinn, das Buch in einem Zug von vorn bis hinten durchzulesen. Zu viele Nuancen, starke Sprachbilder, biblische Bezüge, wertvolle Gedankengänge würden so überlesen. Keunes Sprache ist wunderbar dicht und immer wieder überraschend kreativ. Deshalb ist es viel besser und ergiebiger, täglich einen Text zu lesen und zu meditieren. Dann wird der Leser, die Leserin von diesen Texten reich beschenkt. So vermag das Buch uns zu helfen, inmitten all der Trümmer und Trauer das Träumen nicht zu verlernen und die Hoffnung nicht zu verlieren, die uns sagt:
Es werden wieder Tage sein
Ein neuer Morgen
Ein neuer Mensch (26)
Felix Senn
Felix Senn, Dr. theol., Dozent für systematische Theologie und freiberuflich tätig. Von 1995–2015 Studienleiter bei theologiekurse.ch, von 2016–2020 Bereichsleiter Theologische Grundbildung am Theologisch-pastoralen Bildungsinstitut TBI, Zürich.
«Scheunen voll Wind» (Jacqueline Keune) – Buchrezension von Wolfgang Broedel
Das alte Haus des Glaubens in eine neue Landschaft hineingeführt
Dieses Buch ist wie ein Weg durch eine Landschaft. Einfache Worte, starke Bilder. Das Leben zeigt sich von all seinen Seiten. Wer die kurzen Gebete und Gedichte ruhig mitgeht, in dem wachsen die Gefühle für Erde, Zärtlichkeit, Licht im Dunkel, Mitmenschlichkeit, Freude und Fest, auch für Solidarität und konstruktiven Widerstand. Früher hätte man gesagt: Man spürt den Himmel auf Erden, die Nähe Gottes. Die grosse Kunst von Jaqueline Keune besteht darin, dass sie uns in das alte Haus des Glaubens wie in eine neue Landschaft hineinführt. Dort treffen wir auf das Leben, wie wir es kennen, lieben oder auch fürchten – und alles bekommt einen tieferen Klang, lädt sich auf mit Geschmack, Charme, Leidenschaft und Kraft.
Wer ein Gebet oder ein Gedicht aus diesem Buch im Gottesdienst, bei einer Abschiedsfeier oder einer Taufe einsetzen möchte, sollte sich bewusst sein, dass hier Kraftnahrung verabreicht wird. Bei Lesern und Hörern braucht es die Bereitschaft, sich wirklich berühren zu lassen. Die Texte von Jaqueline Keune eignen sich nicht für ein Spiel mit schönen Worten. Sie setzen liturgische Energie frei bei Windrädern, die dem Wind hinreichend Kraft entgegensetzen. Sonst bleibt es bei «Scheunen voll Wind», im Gedicht «Hunger» (S. 30) ein Bild für menschliche Not.
Man könnte den Titel des Buches auch positiv verstehen: Diese Gebete und Gedichte sind wie «Scheunen voll Wind», wie Gefässe voll des heiligen Geistes. Ist es nicht genau diese Qualität von Sprache, auf die wir in Liturgie und Verkündigung schon lange warten?
Die kraftvolle Zartheit der Wortgebilde von Jacqueline Keune wird durch die Bild- und Formgestalt des Buches unterstrichen. Manchmal ist der Druck sehr zart (für ältere Menschen vielleicht schwer leserlich). Oder liegt auch in dieser Eigenart des Buchs ein sinnvoller Impuls?
Wolfgang Broedel
«Sachbuch Religionen» (W. Bühler / B. Bühlmann / A. Kessler)
Buchrezension von Ine Baeyens
Sachbuch Religionen – ein beeindruckendes und spannendes Lehrbuch
Das „Sachbuch Religionen“ von Willi Bühler, Benno Bühlmann und Andreas Kessler (Hrsg.) ist mehr als eine Einführung in die grossen Religionen der Welt. Es spricht sowohl aktuelle Problematiken als auch die durch die Massenmedien beeinflusste veränderte Wahrnehmung von Religionen an. Weiter gibt es einen Einblick in die gelebte religiöse Vielfalt in der Schweiz.
Die religiöse Landschaft in Europa und in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Das Christentum ist längst nicht mehr die dominierende Religion. Während die Zahl der Kirchengänger abnimmt und die der Konfessionslosen steigt, wächst die Vielfalt der Religionen in unserer Gesellschaft. Das „Sachbuch Religionen“ zeigt auf, wie diesem religiösen Pluralismus in der Schweiz begegnet wird. Während die einen die vielen Religionen als Bereicherung der eigenen Kultur erleben, empfinden andere sie als Bedrohung.
Was sind Gründe für die Faszination oder Ablehnung einer anderen Religion? Wie sieht die religiöse Landschaft in der Schweiz aus? Was versteht man überhaupt unter „Religion“? Auf diese und weitere Fragen liefert das Buch in Form von Reportagen, Interviews, Porträts, Zitaten und Quellentexten viele Antworten. Innerhalb der einführenden Kapitel in die fünf grossen Religionen der Welt werden historische und aktuelle Fragestellungen thematisiert. Dabei wird die Diskussion um das Minarettverbot ebenso aufgegriffen wie der Konflikt in Israel oder die Verstösse der Schweizer Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkrieges
Gesichter der Religionen
Auch wenn die Frage „Was ist Religion?“ eingangs gestellt wird, ist es nicht die Absicht der Autoren, eine Definition von Religion zu geben. Vielmehr versuchen sie über verschiedene Gesichtspunkte zu beleuchten, was das Wesen der Religion ausmacht: Wie zeigt sich Religion, wie wirkt sie, woher kommt sie, was ist ihre ethische, politische und weltanschauliche Funktion? Religionen sind sinnstiftend und weisen ideologische, rituelle, psychische und sogar ästhetische Dimensionen auf. Religionen lassen sich vielleicht eher über sinnliche Eindrücke als über Worte erfassen. „Jede Religion hat ihren eigenen ‚Geruch’, ihre typischen Farben, Klänge, Stoffe, Kleider, Räume und Landschaften“, schreiben die Autoren in der Einleitung.
So ist die lebhafte Darstellung des Buches mit seinen verschiedenen Textsorten und zahlreichen Bildern nicht zufällig gewählt. Durch seine Form bringt das Buch die Vielseitigkeit der Religionen zum Ausdruck. Dies veranschaulichen vor allem die Bilder: Sie zeigen religiöse Symbole, Feste und Bauten, ein Rockkonzert bei einem freikirchlichen Gottesdienst, eine Friedensdemonstration, ein Stop-AIDS-Werbeplakat oder ein menschlicher Arm mit einer im Konzentrationslager eintätowierten Nummer. So unterschiedlich sind die Aspekte, die wir mit Religion verbinden.
Allem voran sind die Bilder Zeugnisse von Menschen, die ihre Religion leben. In den als „Gesichter der Religionen“ betitelten Reportagen kommen vor allem jugendliche Gläubige zu Wort, welche über die Bedeutung, die Religion für sie hat, berichten. Im Kapitel „Christentum“ wird das Porträt einer jungen Katholikin vorgestellt, welche sich für die Lockerung der konservativen Tendenzen der katholischen Kirche einsetzt. Ferner dokumentieren die Reportagen religiöse Feste und Rituale. Im Kapitel „Hindu-Religionen“ wird das Tempelfest in Adliswil beschrieben, an dem jährlich über 4000 Tamilen aus der Schweiz und Deutschland teilnehmen.
Veränderte Aufmerksamkeit von Religionen
Religionen sind in unserer Gesellschaft gegenwärtig und aktuell. In einem Interview mit dem Soziologieprofessor Gaetano Romano wird der Frage nachgegangen, ob es eine „Rückkehr der Religon(en)“ gebe. Das Bedürfnis nach Spiritualität oder die zunehmenden fundamentalistischen Tendenzen seien nie verschwunden, sagt Romano. Vielmehr habe dieser Eindruck einer Wiederkehr der Religion mit einer veränderten Wahrnehmung zu tun. In jüngster Zeit wurden Religionen durch die Massenmedien stärker ins Zentrum des Interesses gerückt. Wenn die Medien gewisse Erscheinung wie das Kopftuch pauschal als religiöse Phänomene codieren, führt das zu einer veränderten Aufmerksamkeit einer Religion wie dem Islam.
Auch das Bedürfnis nach Religion und Spiritualität sei nichts Neues. Neu ist nur, dass im Zuge der Säkularisierung religiöse Gemeinschaften sich vermehrt von Institutionen wie der Kirche lösen und eigene Organisationsformen suchen. Weiter spricht das „Sachbuch Religionen“ von der Faszination, welche andere Religionen in uns auslösen, etwa der Buddhismus, der sich vielleicht gerade als gottlose Religion in Mitteleuropa grosser Beliebtheit erfreut.
Aufruf zur Toleranz
Die Verknüpfung einer Einführung in die Welt der Religionen mit aktuellen Themen macht das „Sachbuch Religionen“ zu einem beeindruckenden und spannenden Lehrbuch. In erster Linie dient es einem bekenntnisfreien Religionsunterricht am Gymnasium, richtet sich aber darüber hinaus an alle, die sich für Religionen interessieren. Neben vielen weiterführenden Links und Literaturhinweisen rufen die Autoren auf der Internetplattform zum Feedback und Dialog auf.
Schliesslich sei nochmals betont, dass die Autoren mit ihrem Buch einen wichtigen gesellschaftspolitischen Fokus setzen: Sie möchten einen Beitrag zur Toleranz leisten, zur Akzeptanz der religiösen Vielfalt in unserer zunehmend multikulturellen Gesellschaft. Oder um es mit dem im Buch vorgestellten Hindu-Priester Sasitharan Ramakrishnasarma zu sagen: „In Sri Lanka ist es üblich, dass Hindus nicht nur ihre Tempel, sondern auch katholische Kirchen besuchen. Das muss sich nicht gegenseitig ausschliessen.“
Ine Baeyens
Rezension von Ine Baeyens, publiziert im Internet-Portal www.religion.ch
«Sachbuch Religionen» (W. Bühler / B. Bühlmann / A. Kessler)
Buchrezension von Ine Baeyens
Bessere und schlechtere Religion? – Ein Überblick über fünf Weltreligionen für den Unterricht
«Sachbuch Religionen» heisst ein neues Werk für den bekenntnisfreien Religionsunterricht an Gymnasien. Es bietet reiches Material, aber wenig didaktische Hilfestellung, und die Neutralität der Darstellung wird nicht ganz durchgehalten.
Mit viel Spannung wurde in der deutschsprachigen Schweiz das «Sachbuch Religionen» mit Beiträgen von Luzerner Religionslehrern und Religionswissenschaftlern erwartet. Das Buch umfasst knapp 300 Seiten, enthält viele Abbildungen und Quellentexte und ist ansprechend gestaltet. Es wurde für einen bekenntnisfreien Religionsunterricht an Gymnasien konzipiert, richtet sich aber auch an ein breites Publikum, das sich für Religionen in kulturell pluralen Gesellschaften interessiert.
Im ersten, einleitenden Teil geht es um die Definition von Religion (Andreas Kessler); im zweiten Teil werden fünf religiöse Traditionen vorgestellt: Hindu-Religionen (Frank Neubert, Willi Bühler), Buddhismus (Martin Baumann), Judentum (Simone Rosenkranz, Simon Erlanger), Christentum (Willi Bühler, Andreas Kessler), Islam (Samuel M. Behloul). In beide Teile sind Porträts, Interviews und Reportagen (Benno Bühlmann) eingestreut.
In der Einleitung wird der Begriff Religion zunächst in seinen vielfältigen Bedeutungen sprachlich, historisch, kulturell und dimensional erläutert. Danach legt sich der Autor auf eine Religionsdefinition fest, die vom evangelischen Theologen Gerd Theissen stammt: «Religion ist ein kulturelles Zeichensystem, das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer letzten Wirklichkeit verheisst.» Diese Bestimmung von Religion versteht sich als Weiterentwicklung einer bekannten Definition von Clifford Geertz, trägt jedoch gegenüber dem Original eine positive Wertung ein. In diesem ersten Teil gibt es zwei Exkurse, die in Kürze wichtige empirische Informationen und Interpretationen der aktuellen religiösen Situation liefern: ein Interview mit dem Soziologen Gaetano Romano zur (vermeintlichen) Rückkehr der Religion sowie eine Kurzdarstellung zu den empirisch fassbaren Entwicklungen von Religionen in der Schweiz durch den Religionssoziologen Jörg Stolz.
Wohlwollend-positive Grundhaltung
Im zweiten, umfangreicheren Teil des Buches werden in farblich jeweils unterschiedlicher Seitenaufmachung die einzelnen Religionen dargestellt. Die Komposition der Kapitel ist abwechslungsreich; die Länge beträgt zwischen 40 (Hindu-Religionen) und 56 Seiten (Christentum). Die Kapitel folgen teilweise, aber nicht durchgängig demselben Aufbau, was den Leser etwas irritiert. Inhaltlich werden die fünf religiösen Traditionen unterschiedlich präsentiert: Die Kapitel über Judentum und Christentum enthalten weitaus weniger explizite Bezüge auf die geschichts- und sozialwissenschaftliche Quellenlage als die übrigen Kapitel. Sie sind aus einer deutlich erkennbaren Nähe heraus geschrieben, und die Grundhaltung ist ähnlich wie im Buddhismus-Kapitel wohlwollend-positiv. Kritische Wahrnehmungen dieser Religionen, welche in der Gesellschaft kursieren, werden kaum thematisiert.
Im Kapitel zum Islam werden solche Positionen dagegen häufig aufgegriffen und diskutiert. Auf diese Weise entsteht beim Leser der Eindruck, es zwar nicht mit «wahren» und «falschen», jedoch mit «besseren» und «schlechteren » Religionen zu tun zu haben.
Eingefügt in diese Darstellungen der Religionen finden sich Bilder, Texte aus kanonischen Schriften, Berichterstattungen, Kommentare von Religionsgelehrten sowie Texte aus der akademischen Sekundärliteratur. Diesen umfangreichen Einschüben fehlt jedoch die nähere Erläuterung. Will ein Lehrer diese Quellen im Unterricht verwenden, ist eine zeitintensive Erarbeitung der jeweiligen Kontexte gefordert.
Auch andere didaktische Hilfestellungen gibt es im «Sachbuch Religionen» kaum. Dafür muss man auf eine Internetplattform zugreifen, die diese Lücke füllen soll. Das ist schade, zumal den Lehrkräften heute weniger Mangel an Material als das fehlende didaktische Instrumentarium für einen kulturkundlichen Zugang zu den verschiedenen Religionen zu schaffen macht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Buch einen guten, grafisch ansprechenden Überblick über fünf wichtige religiöse Traditionen gibt und Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II (weniger wohl der Sekundarstufe I) angemessen ist. Es bietet einen reichhaltigen Fundus an Bild- und Textmaterialien und nimmt Bezug auf Religionen, wie sie in der Schweiz gelebt werden. Als Nachteil des Buches erweisen sich die fehlenden oder teilweise irreführenden didaktischen Hinweise. Auch ist die beabsichtigte Gleichwertigkeit bei der Darstellung der Traditionen nicht ganz gelungen. Trotz dieser Einschränkung ist das Buch sehr lesenswert und Schülern wie Lehrkräften zur Lektüre empfohlen.
Katharina Frank*
Quelle: Reformierte Presse Nr. 19 – 14. Mai 2010
* Katharina Frank ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Religion-und-Kultur-Lehrerausbildung am Religionswissenschaftlichen Seminar an der Universität Zürich.